Auftakt und Keynote
Zur Eröffnung betonte Peter Salden (KI:edu.nrw) die Rolle der Konferenz als Plattform, um „blinde Flecken zu identifizieren“ und den communityübergreifenden Austausch zu stärken. Die Leitfrage lautete dabei: „Naht der Untergang oder kommt die Erlösung?“ – ein augenzwinkernder Hinweis auf die ambivalenten Gefühle, die viele mit dem Einsatz von KI verbinden. Informativ war die Keynote von Prof. Dr. Sabine Seufert, (Universität St. Gallen) mit dem Titel „Prompt ↔ Insight: Wie GenAI und Learning Analytics sich wechselseitig ermöglichen“. Sie zeigte auf, wie Prompt‑Dialoge mit GPT‑basierten Lernsystemen nicht nur Schreibunterstützung liefern, sondern auch Daten, die mithilfe von Learning‑Analytics die adaptive Optimierung von KI‑Feedback, die differenzierte Erkennung von Kompetenzen und eine dateninformierte ethische Steuerung ermöglichen. In dieser wechselseitigen Dynamik können neue Prüfungs‑ und Trainingsformate entstehen, die Schreib‑, Denk‑ und Interaktionsprozesse ganzheitlich erfassen, ohne das Schreiben vollständig abzuschaffen.
Politische Perspektiven
Am zweiten Tag gab es eine spannende Podiumsdiskussion, an der unter anderem die nordrhein-westfälische Wissenschaftsministerin Ina Brandes teilnahm. Dadurch wurden auch politische Perspektiven aufgezeigt. Sie stellte klar, dass KI aus der Hochschullehre und -forschung nicht mehr wegzudenken ist und fügte hinzu: „Die natürliche Auslese wird dafür sorgen, dass es keine Veranstaltungen mehr gibt, in denen KI verboten ist.“ Mit Blick auf Nordrhein-Westfalen betonte sie, dass es richtig ist, in gemeinsame Infrastrukturen statt in parallele Einzellösungen zu investieren. Es sei nicht finanzierbar, wenn „36 Hochschulen in NRW 36-mal dieselben Probleme lösen“. Was könnte Berlin daraus lernen? Aus hochschulischer Sicht ergänzte Prof. Dr. Yvonne-Christin Knepper-Bartel, dass KI nicht nur fachliche, sondern auch didaktische und barrierefreie Weiterentwicklungen ermögliche und mahnte mehr Mut an. Betont wurde auch, dass Hochschulen sich stärker an den Kompetenzbedarfen des Arbeitsmarkts orientieren müssten.
Workshops und Zukunftsbilder
Neben den Keynotes und Diskussionsrunden bildeten die Workshops das Herzstück der beiden Konferenztage. Hier wurden neue Ansätze nicht nur vorgestellt, sondern auch erprobt. Die Workshops machten deutlich, dass Hochschulen längst mit eigenen Strategien experimentieren, um KI souverän, sicher und praxisnah einzusetzen. Unter dem Titel „Future Quests der Hochschullehre“ entwarfen Expert*innen wie Prof. Dr. Benjamin Paaßen oder Florian Rampelt Szenarien, die von der „transhumanistischen Hochschule“ mit „direktem Upload ins Gehirn“ bis zur „Hochschule der Superassistenten“ reichten. Im Zentrum stand die Frage: Welche Rolle spielen künftig AI Literacy und menschliche Kompetenzen, wenn KI immer mehr Aufgaben übernimmt?
Stimmen aus der Community
Neben den offiziellen Beiträgen waren es auch die persönlichen Reflexionen, die den Charakter der Konferenz prägten. Ein LinkedIn-Post von Ben Lenk-Ostendorf brachte es auf den Punkt und ist sogleich ein gutes Fazit für diese Learning AID 2025:
- KI-Infrastruktur als Flickenteppich: Gefordert wurde eine gemeinsame deutsche Hochschul-Infrastruktur, um Ressourcen effizient zu bündeln.
- Akkreditierung neu denken: Studiengänge sollten nur dann zugelassen werden, wenn sie Inhalte vermitteln, die nicht trivial durch KI ersetzt werden können.
- Didaktische Skills verbreitern: Noch erreichen wir vor allem Lehrende, die ohnehin interessiert sind. Es braucht „trojanische Didaktik“ und verpflichtende Schulungen, damit wirklich alle Lehrenden die nötigen Kompetenzen entwickeln.
- Studierende stärker unterstützen: Angesichts unsicherer Zukunftsperspektiven, steigender Lebenshaltungskosten und zusätzlicher Erwartungen an Engagement sei die Belastung „gerade richtig krass“.
Die nächste Learning AID dürfte diese Fäden weiter aufnehmen oder die KI-Blase ist 12,5 Monaten geplatzt (so orakelt Benjamin Paaßen ![]() ).
).
Zum offiziellen Rückblick geht´s hier.

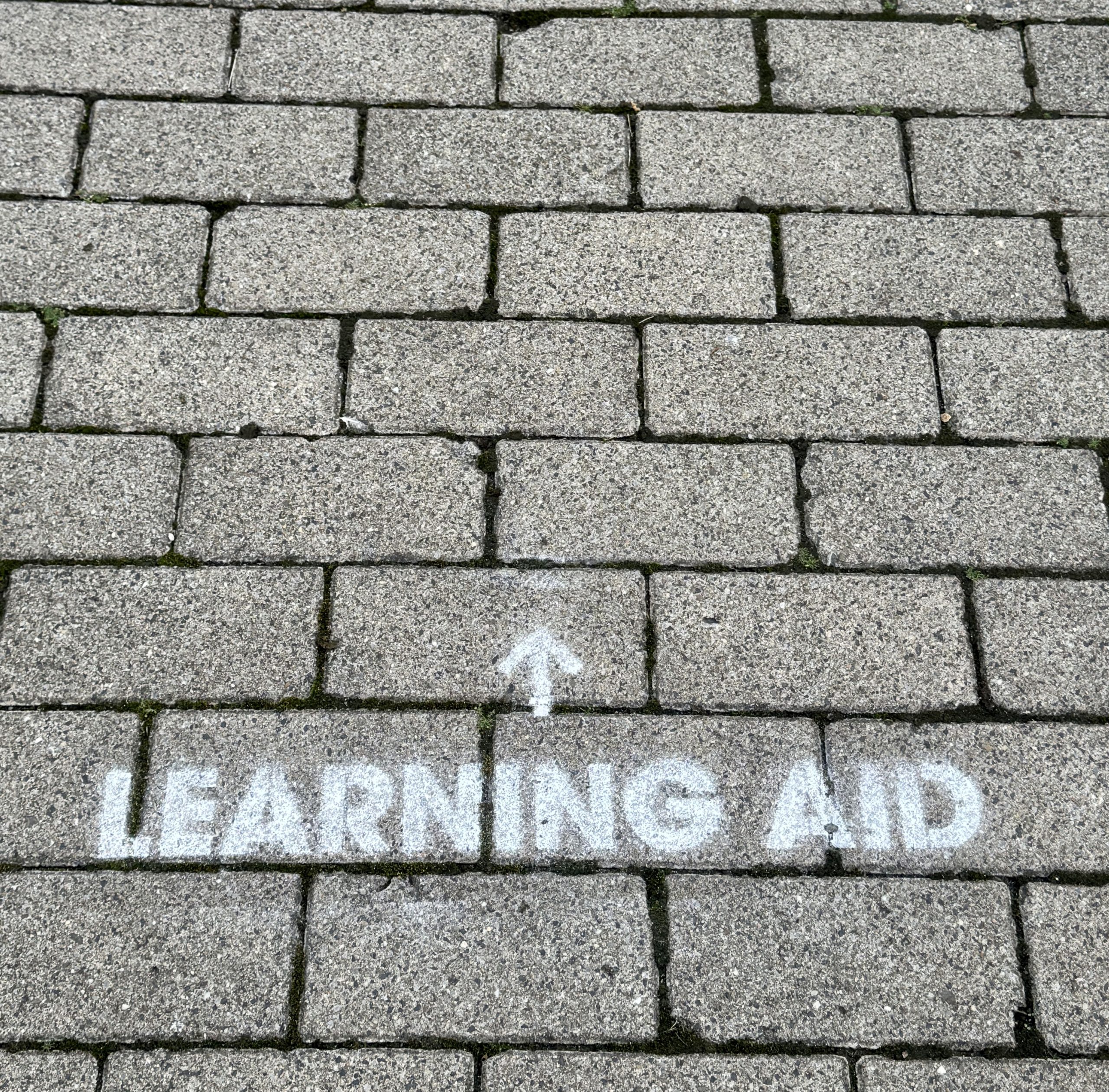

0 Kommentare