In meinem heutigen Blog- Beitrag möchte ich Ihnen über ein interessantes Feldexperiment berichten, welches dieses Wintersemester 2013/14 an der HWR Berlin erstmalig von Prof. Dr. Birkenkrahe in der Lehrveranstaltung Betriebliche Informationssysteme durchgeführt wird.
In diesem Experiment schreiben die Studenten unter Anleitung (Supervision durch Dozent) etappenweise ihre wissenschaftliche Hausarbeit, die neben einer Gruppenleistung als Teilleistung in die Benotung einfließt.
Supervision[2] heißt, dass der Dozent in regelmäßigen Abständen, anfangs wöchentlich, Themengebiete bezüglich wissenschaftlichen Arbeitens erläutert, Aufgaben diesbezüglich erteilt und diese dann von den Studenten bis zur nächsten Woche in Moodle gebloggt werden müssen. Am Anfang jeder Stunde greift der Dozent interessante Blogs auf und erläutert anhand dieser Blogs, was zum Beispiel beim Verfassen einer Einleitung zu beachten ist. Zeitgleich bearbeitet der Dozent ebenfalls die gestellte Aufgabe, gibt somit ein konkretes Beispiel vor und skizziert seine Gedankengänge dabei. Des Weiteren kommentiert der Dozent bei Bedarf die Beiträge der Studierenden. Genauso ist es Aufgabe der Studenten, die Beiträge untereinander zu lesen und zu kommentieren.
Außerdem müssen die Studierenden ihre Hausarbeit zeitgleich bei Google Docs verfassen. Dort hat nur der Dozent Zugriff und kann bei Bedarf eingreifen. Zum Beispiel um auf Rechtschreibung, grammatikalische Fehler oder Zeitverzug hinzuweisen.
Abgerundet wird das Ganze durch Gastbeiträge von erfahrenen Wirtschaftswissenschaftlern, die z.B. Vorträge über Methodik oder “Science Slam” halten.
Dieses Vorgehen geschieht jedoch parallel und ändert nichts an den eigentlichen Lernzielen der Lehrveranstaltung.
Ziel des Experiments ist, die Qualität der wissenschaftlichen Hausarbeiten nachhaltig zu verbessern und den Studenten durchgehend formatives Feedback[1] zu geben um dadurch einen tatsächlichen Lerneffekt zu gewährleisten. Bisher wurde beobachtet, dass eine Vielzahl der Studenten am Ende der Vorlesung ihre Hausarbeit abgaben ohne Feedback oder Verbesserungsvorschläge seitens des Dozenten erhalten zu haben. Die Möglichkeit der Einsicht und Nachbesprechung wird in den meisten Fällen kaum von den Studierenden wahrgenommen.
In einer parallel dazu stattfindenden Lehrveranstaltung Unternehmensmodellierung, die ebenfalls von Herrn Prof. Dr. Birkenkrahe gehalten wird, ist eine Gruppe damit beschäftigt, den Prozess “Prüfungseinsicht” mit Hilfe des Webeditors Signavio in BPMN 2.0 zu modellieren. Dadurch soll u.a. der Wert der Einsicht als Feedback-Prozess für Studierende erhöht werden.
Gleichzeitig wird dieses Feldexperiment im Rahmen meiner Bachelor- Thesis von mir begleitet. Ich untersuche die jeweiligen Elemente der Lernprozesse (Supervision, Blogging, usw.) auf ihre Tauglichkeit und werde am Ende diskutieren, ob diese zum gewünschten Erfolg führen oder nicht.
Ohne meinem Ergebnis vorgreifen zu wollen, finde ich diese Lernprozesse von der Theorie her mehr als überfällig. Auf mein bisheriges Studium zurück blickend, stelle ich genau die vorangegangene Problematik fest. Die wenigen wissenschaftlichen Hausarbeiten, die ich geschrieben habe, wurden am Ende des Semesters abgegeben und die Benotung wurde von mir kommentarlos angenommen. Folglich habe ich selten Feedback erhalten, weder inhaltlich, noch über die Qualität meiner wissenschaftlichen Arbeitsweise. In vielen Lehrveranstaltungen, in denen sich die Note aus kombinierten Prüfungen zusammensetzte, meist aus Hausarbeit und mündlichem Test, war die Verwirrung noch größer. War meine Leistung in der Hausarbeit schlechter oder umgekehrt?! Die Termine für die Klausureinsicht, waren natürlich immer zu ungünstigen Zeiten bzw. man war einfach zu bequem. Ich glaube, dass auch der Gedanke, das bringt doch eh nichts eine große Rolle gespielt hat.
Dieses neue Konzept, sollte es sich bewähren, könnte die Qualität der wissenschaftlichen Arbeiten meiner Meinung nach um ein Vielfaches steigern. Erstens weil ich schon während der Konzeption Anregungen und Verbesserungsvorschläge erhalte und diese somit gleich umsetzen kann. Zweitens sofern vom Dozenten vorgesehen, eine Art Bewertung bei Google Docs über die Kommentarfunktion, für künftige Hausarbeiten lehrreich sein könnte.
Mir ist unklar, in wie weit die Supervision für die Dozenten Mehrarbeit bedeutet. Insofern kann ich natürlich nicht beurteilen, ob diese bei allen Professoren und Dozenten auf Anklang stoßen wird. Dies bleibt abzuwarten.
[1] Nicol, David J, and Debra Macfarlane‐Dick. „Formative assessment and self‐regulated learning: A model and seven principles of good feedback practice.“ Studies in higher education 31.2 (2006): 199-218.
[2] Glickman, Carl D.; Gordon, Stephen P.; Ross-Gordon, Jovita M. „SuperVision and Instructional Leadership: A Developmental Approach.“ Sixth Edition (2001). Needham Heights: Allyn & Bacon/Longman Publishing.

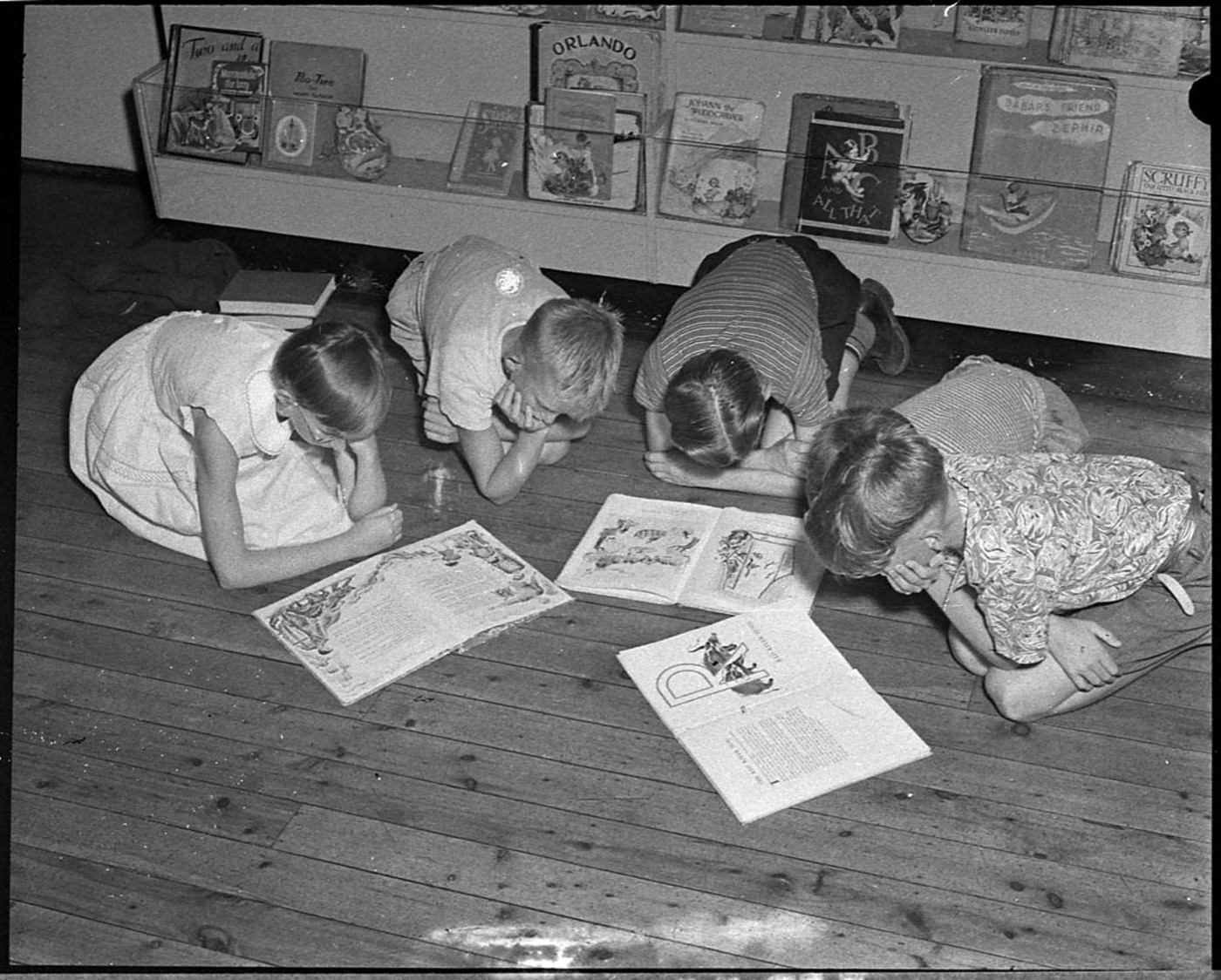
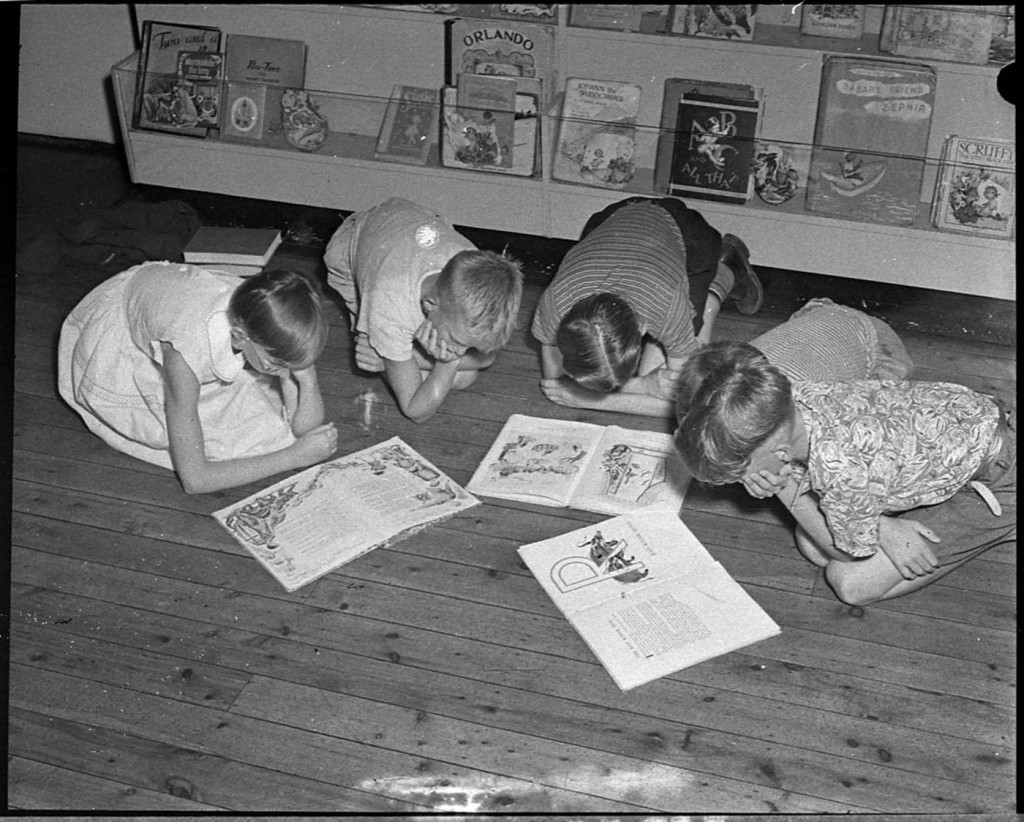

0 Kommentare